| |
| inici | |
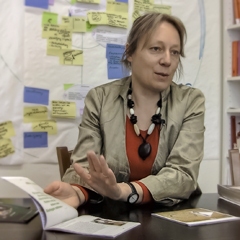 |
Martina Schmidt
-Vídeo DE -Transcripció .PDF DE -Biografia CAT DE ES publicacions
|
|---|
Entrevista amb Martina Schmidt (Membre de la Fundació “Brot für alle”: Directora del despatx francófon de la Fundació a Lausanne) / Gespräch mit Martina Schmidt Mitglied der Stiftung „Brot für alle“ Leiterin des französischsprachigen Büros der Stiftung in Lausanne) / Entrevista con Martina Schmidt (Miembro de la Fundación “Brot für alle”: Directora del despacho francófono de la Fundación en Lausanne). L'entrevista es va realitzar al maig del 2010 a Berna. / Das Gespräch fand im Mai 2010 in Bern statt. No es possible imaginar-se un mon just sense l’autodeterminació dels homes. Un exemple concret és el comerç just. |
| Entrevista / Interviews / Entrevista |
Geschichte und Aufgaben der Stiftung Brot für alle #00:00:11#
Brot für alle ist der Entwicklungsdienst der evangelischen Kirche in der Schweiz, also des schweizer evangelischen Kirchenbundes. Seit 2004 ist Brot für alle eine Stiftung des Kirchenbundes. Das ist vielleicht ganz wichtig. Vorher war es ein Verein der schweizerischen Landeskirchen oder Kantonalkirchen. Aber ursprünglich, am Anfang von Brot für alle hat eine Sammelaktion gestanden. 1961 gab es eine Aktion, wo aufgerufen wurde, solidarisch zu sein mit den Hungernden in der Welt. Diese Aktion hat damals, glaube ich, 16 Millionen Schweizer Franken eingebracht und so hat man dann Jahr um Jahr wieder solche Sammelaktionen gemacht. Also es war eine lose Aktion, wo die Schweizer Bevölkerung wirklich drauf eingestiegen ist. Dann hat sich Brot für alle eben entwickelt. Es ist jetzt diese Stiftung, wie gesagt. Ja, und was tun wir? Hauptsächlich hat Brot für alle vier Mandate. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit über Probleme der Armut, Ungerechtigkeit, ungerechte Strukturen. Diese Arbeit der Sensibilisierung leisten wir hauptsächlich in der Kampagnenzeit, also in den sechs Wochen vor Ostern, in der ökumenischen Kampagnenzeit. Das ist also ein wirklich großer Mandatsauftrag von Brot für alle. Dann gibt es den Mandatsauftrag der Entwicklungspolitik. Darüber haben Sie auch mit Herrn Baumann schon gesprochen. Da geht es stärker noch um politische Lobbyarbeit, um capacity building, empowerment, advocacy. Außerdem haben wir auch den Auftrag, Fundraising zu machen, Gelder zu sammeln für Entwicklungshilfeprojekte im Süden. Genau genommen werden diese Gelder an unsere Schweizer Partnerorganisationen verteilt. Diese Schweizer Partnerorganisationen sind aus der Missionstätigkeit und aus der Entwicklungshilfetätigkeit in der Bewegung der sechziger und siebziger Jahre entwachsen. Unser Geld, das was wir sammeln, geht nie direkt in den Süden. Es geht immer über eine Schweizer Organisation zu einem Projektpartner in den Süden. Das ist noch ganz wichtig. Wir sind also nicht direkt operativ in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Natürlich ist diese Netzwerkfunktion mit den Schweizer Partnerorganisationen auch mit einer Betreuung verbunden, das heißt, wir überwachen die Qualität der Projekte dieser Partnerorganisationen.
Organisation und Mittel der Sensibilisierungskampagnen #00:04:28#
Diese Kampagnen sind hauptsächlich, zumindest in der Vergangenheit, auch über die Kirchengemeinden gelaufen. Das ist unser Hauptpublikum innerhalb dieser Kampagnen, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren sind die Kampagnen immer mehr geöffnet worden hin zu der breiten Schweizer Öffentlichkeit. Das heißt, man kann die Trennung gar nicht so stark machen. Damit unsere Kampagnen funktionieren, haben wir eben dieses Netzwerk der Kirchengemeinden, der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Ohne das Engagement der Leute vor Ort in den Regionen würden unsere Kampagnen überhaupt nicht funktionieren können. Dafür erarbeiten wir eine Reihe von Materialien. Es gibt dazu die Agenda, diesen berühmten Kalender, der eine Begleitung ist in der Fastenzeit, also in den sechs Wochen vor Ostern. In dieser Agenda wird immer das Kampagnethema aufgenommen. Zum Beispiel haben wir hier den großen Zyklus „Recht auf Nahrung“ über mehrere Jahre hinweg. Hier ging es, damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt, um Zugang zu Land und Zugang zu Ernährungssicherung. Also das heißt, eigene Produktionsmethoden haben, sein eigenes Land bestellen dürfen. In diesem Jahr, 2010, ging es auch wieder um das Recht auf Nahrung, das große Oberthema, aber dann darunter das Thema des Handels, also, inwieweit der internationale Handel das Recht auf Nahrung beeinträchtigt. Das ist unsere Arbeitsweise, dass wir ein Thema aufgreifen und dieses Thema in Verbindung setzen mit Inhalten des christlichen Glaubens. So wird eben auch die Sensibilisierung angestoßen bei Menschen, die vom Glauben inspiriert sind, also die Mitglieder unserer Kirchengemeinden sind und die sich Fragen stellen und die wissen, dass Armut kein Schicksal ist, oder dass es keine Fatalität ist, sondern Armut ist hausgemacht durch wirtschaftliche Strukturen. Der Kalender ist ein wichtiges Instrument. Jemand hat neulich gesagt, der Kalender ist unsere Toblerone, unser Aushängeschild. Diese Toblerone, auf die wollen wir nicht verzichten, wenngleich auch immer mal wieder gesagt wird, das sei eigentlich ein veraltetes Instrument und wer gucke schon noch alle Tage in diesen Kalender. Aber ursprünglich ist es wirklich so gedacht, dass es eine Begleitung ist, für jeden Tag in der Fastenzeit. Da hat man dann so eine Anregung. „Du kannst nicht die eine Hälfte eines Huhnes zum Kochen und die andere zum Eierlegen nehmen.“ Wir versuchen halt, auch Sprüche aufzunehmen und Zitate aus dem Süden und informieren dann auch über die Projektarbeit im Süden und über wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge. Jeden Tag gibt es so eine Reflexion. Viele Menschen in den Kirchengemeinden, vor allem die ältere Generation, benutzen diesen Kalender noch so, indem sie ihn jeden Tag lesen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die ihn nicht zum täglichen Hausgebrauch benutzen. Dann gibt es unsere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Die nehmen sich etwas heraus, was ihnen zusagt und benutzen diesen Kalender in der Katechese oder auch im Gottesdienst. Da kann dann etwas zitiert werden. Das Kirchengemeindepublikum ist das eine. Dann haben wir natürlich auch eine große nationale Medienkampagne mit Plakaten. Es gibt immer eine Medienkonferenz, wo wir die Kampagne eröffnen. Wir stellen fest, eben auch in diesem Jahr, 2010, diese Plakate dort mit dem "World Trade Poker", die haben wirklich gezündet. Die Leute haben diese Plakate gesehen und mit uns in Verbindung gebracht. Und wir hatten noch dazu das Glück, dass das Pokerspiel bei der jüngeren Generation gerade wieder total in ist. Das wussten wir auch, als wir diese Kampagne entwickelt haben. Ja, das ist so die breite Öffentlichkeit.
Wie das Gefühl der Ohnmacht zu bekämpfen ist #00:11:19#
Wir versuchen immer auch Alternativen aufzuzeigen und Lösungswege. Die Leute wollen das auch, dass wir ihnen Handlungsmethoden geben. In dieser Kampagne zu unfairem Handel haben wir natürlich ganz stark den fair trade in den Vordergrund gehoben und auch gemerkt, dass fair trade wirklich in der Schweizer Bevölkerung etwas ist, was auch total akzeptiert ist und viele Menschen wirklich anregt, fair zu konsumieren. Wir legen ebenfalls einen starken Akzent darauf zu sagen, dass sie, indem sie lokale Produkte konsumieren, auch einen Beitrag leisten zu einer gerechteren Gesellschaft. Sie können die Direktvermarktung unterstützen von Bauernorganisationen. Das sind so Schritte, die wir hier im Kalender auch beschreiben, aber die wir auch darüber hinaus über die Medienkonferenz und über andere Materialien publik machen.
Eine politische Kampagne in der Computerindustrie von Hongkong #00:12:57#
Ja, das spielt eine Rolle, die politische Aktion. Man muss unterscheiden: Nicht jede Kampagne ist eine politische, weil es auch ein großer Aufwand ist. Aber wir haben zum Beispiel 2007 eine Computerkampagne gestartet zu den Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie und da haben wir zusammengearbeitet mit Partnern in Hongkong und auch auf der anderen Seite mit den Produzenten von Computern, also der Computerindustrie, mit HP (Hewlett Packard), Acer und anderen. Wir haben es versucht über den Mechanismus des Respektierens von ethischen Produktionssituationen: Was wollen die Verbraucher? Wie ist die Situation der Produzentinnen? – Diesen Mechanismus haben wir versucht in Gang zu bringen. Das heißt auf der einen Seite, dass die Arbeiterinnen vor Ort über ihre Rechte aufgeklärt werden, auf der anderen Seite, dass der Computerindustrie klar wird, dass sie auch ethische Prinzipien respektieren müssen. Dieses Miteinander-in Einklang-Bringen hat dazu geführt, dass wir jetzt zum Beispiel ein Pilotprojekt laufen haben, wo HP ein Programm der Ausbildung von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Computerindustrie finanziert, wo es darum geht, dass die Menschen ihre Rechte kennenlernen. Also ein Empowerment-Programm. Es ist meistens so auf den Philippinen oder in China vor allen Dingen, dass es die Mädchen sind, vom Lande, die dann in diese Produktionszentren kommen und dort in den Computerfirmen oder Elektronikfirmen angestellt werden. Man kann sagen, 80% bis 90% sind es wirklich Frauen, die dort arbeiten. Junge Frauen, ab 19-20.
Die Lage der Frauen in der Schweiz #00:16:29#
Nun haben die Schweizer Frauen schon einen Vorteil, da sie ja auch schon seit den siebziger Jahren - ich glaube 71 haben sie das Wahlrecht bekommen - und sie haben schon den Vorteil, dass sie stärker emanzipiert und über ihre Rechte aufgeklärt sind. Aber es ist heute in der Schweizer Gesellschaft immer noch so, dass für eine gleiche Arbeit Frauen ein niedrigeres Gehalt erhalten. Also, nicht überall und schon gar nicht bei Brot für alle. Aber in manchen Bereichen der Wirtschaft ist das der Fall.
Der Einfluss der Befreiungstheologie #00:17:39#
Es ist für uns hier wichtig, dass die Befreiungstheologie noch lebendig ist. Sie ist noch lebendig, aber es ist für uns wichtig, weil sie einen Charakter hat, der die Sichtweisen innerhalb unserer Kirchenlandschaft etwas reformieren kann. Das heißt, es geht nicht darum, sich um die Armen zu kümmern, sondern es geht darum, gemeinsam mit den Armen Veränderungsprozesse in die Wege zu leiten. Und das ist ein Oberprinzip, das man immer wieder betonen muss, weil die Rezeption der Befreiungstheologie oft auch in diese Richtung gegangen ist, man müsse sich halt kümmern oder man muss... Ja, die Ethik, also ethische Prinzipien wurden übernommen, aber es ging nicht so weit, dass man gesagt hat, wir müssen grundsätzlich auch unser Kirche sein überdenken, unsere Art, wie wir helfen, überdenken und dass im Zentrum wirklich die vorrangige Option für die Armen steht. Und was heißt das für eine Kirche, die ja eigentlich mehrheitlich und auch in der Geschichte immer wieder auf der Seite einer eher mittelständischen oder Bourgeoisie-Gesellschaft gestanden hat, was auch heute eigentlich noch der Fall ist. Soziale Bewegungen initiieren, Menschen dazu zu verhelfen, ihre Rechte zu kennen, ihre eigene Situation in die Hand nehmen zu können, das ist eigentlich das, was auch im Zentrum unserer entwicklungspolitischen und Sensibilisierungsarbeit steht. Da ist Brot für alle sicherlich ganz stark von der Befreiungstheologie inspiriert. Sie spielt eine Rolle, weil sie ein Hintergrund ist für jegliches Handeln im Bereich von Empowerment. Die Befreiungstheologie hat von capacitação gesprochen und Empowerment ist nichts anderes. Es ist fast so, ich denke, das kann man heute auch feststellen, es ist eine Errungenschaft der Befreiungstheologie, hinter die man nicht mehr zurückgehen kann. Das heißt, in unseren Entwicklungshilfeprojekten, die wir unterstützen, geht es immer auch um diese Empowerment-Dimension. Von daher kann man schon sagen: Es ist nicht direkt die Befreiungstheologie, die da jetzt überall vor Ort zitiert wird, aber diese Empowerment-Dimension, die ist in allen Schritten von Entwicklung ländlicher Gemeinschaften mit im Spiel. Aber es ist nicht so – wir arbeiten nicht nur mit Partnern, die christlich sind. Es ist keine Voraussetzung eine gemeinschaftliche Lektüre der Bibel zu praktizieren.
Die Bedeutung der Hoffnung und wie eine gerechte Welt entstehen kann #00:21:53#
Die Arbeit ist von Hoffnung getragen, das ist ganz klar. Sonst würden wir uns angesichts der Hoffnungslosigkeit mancher Situationen und Strukturen erschrecken lassen. Also es braucht dieser Hoffnung auch daran zu glauben, dass eine konkrete Utopie möglich ist. Vom theologischen Standpunkt her gesehen ist es die Frage des Reiches Gottes - Gottes Reich als konkrete in der Welt realisierbare Utopie ist sicherlich die Motivation, die hinter unserem Handeln steht als Organisation Brot für alle. So dass alle Menschen darüber bestimmen können, wie sie sich ernähren möchten, die Möglichkeit haben, sich um ihr Auskommen um ihre Ernährung zu kümmern, ihre Familien zu ernähren, souverän sind in der Gestaltung ihre Lebens und dass alle satt werden können. Aber nicht nur satt , sondern auch im Sinn ein erfülltes Leben haben zu können. Wir wollen ja auch nicht nur Almosen geben, auf gar keinen Fall. Die Entwicklungszusammenarbeit ist seit vielen vielen zig Jahren darüber hinweg. Es geht wirklich darum, diese Souveränität von Gemeinschaften wieder zu befreien, damit Menschen und Gemeinschaften und Völker ihre wirtschaftliche Situation selbst in die Hand nehmen können und damit alle etwas zum Leben haben. Ein Zeichen davon ist schon auch der faire Handel, wo ganz konkret deutlich wird: Ein anderes Modell von Wirtschaft ist möglich, und zwar so ein Modell, dass die Produzentinnen und Produzenten am Anfang der Kette auch für die Arbeit, die sie getan haben, ein würdiges Gehalt erhalten. Und nicht nur das, sondern dass dabei auch mitbedacht ist, dass die Natur geschützt wird, dass man nicht einfach Raubbau an der Natur betreibt, wenn man landwirtschaftlich produziert. Und noch dazu, dass etwas von dem, was ich erworben habe durch meiner Hände Arbeit auch wieder in die soziale Gemeinschaft zurückfließt und damit in der Entwicklung der Gemeinschaften weiterhin bestehen bleibt. Also, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Eigentlich ist der fair trade, der faire Handel, ja nur eine Vorstufe zu einer gerechteren Welt. Denn natürlich ist es anstrebbar, dass jedes Land auch seine eigene Souveränität haben kann und seine eigenen Märkte entwickeln kann und nicht, dass der internationale Markt und die internationale industrielle Landwirtschaft die Märkte der Entwicklungsländer überschütten mit Produkten aus Europa und den Vereinigten Staaten. Daran arbeiten wir auch: an Handelsstrukturen, die wirklich auch von den Nationalstaaten gemacht werden können. Da wird es wirklich komplex und da wird es spannend. In einer reichen Gesellschaft wie der Schweiz ist es natürlich möglich Fair-Trade-Produkte zu konsumieren. Sie sind erstens gesünder, sie sind besser, sie kosten vielleicht ein bisschen mehr, aber das kann ich mir erlauben. Aber wenn es darum geht, das gesamte wirtschaftliche Modell zu überdenken, wenn es darum geht auch zu überdenken, dass die Schweiz durch ihre Bankenpolitik oder durch ihre Finanzpolitik vor allem dazu beiträgt, dass bestimmte Finanzen aus den Entwicklungsländern herausgezogen werden und auf Schweizer Konten deponiert werden, dann wird es wirklich kompliziert. Die Revolution ist noch weit entfernt. |
Publicacions (selecció) / Veröffentlichungen (Auswahl) / Publicaciones (selección) Martina Schmidt: Protestantisme historique et Libération, Paris, Harmattan,200 |